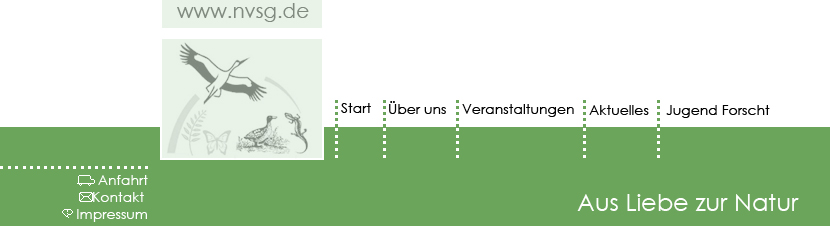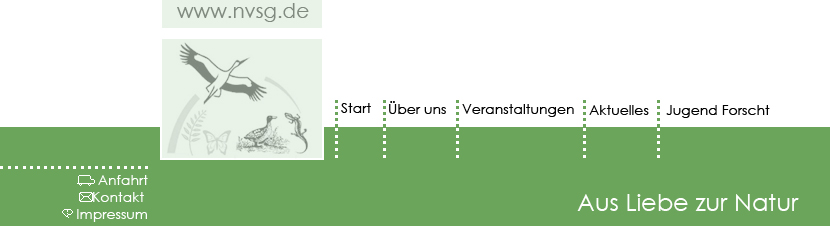Auswirkungen
der Wasserbelebung nach Grander auf das Pflanzenwachstum : Laichwanderung
der Erdkröte in Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchte :
Blindschleichen in der
Goldhole von Hailer
Kurzfassung: Auswirkungen der Wasserbelebung
nach Grander auf das Pflanzenwachstum von Sebastian Binder und Florian
Binder (zurück
zum Seitenanfang)

(von links: Sebastian Binder
und Florian Binder)
Thema
Auswirkungen der Wasserbelebung nach Grander auf das Pflanzenwachstum
ThemenfindungUnsere letztjährige „Schüler
experimentieren“ Arbeit über unseren Naturteich gab den Anstoß
eine Arbeit
über Granderwasser anzufertigen. Unsere Prüfer waren von der
Wasserqualität und der Pflanzenvielfalt
unseres Teiches beeindruckt und regten uns dazu an, uns näher mit
diesem Thema zu beschäftigen.
In einem Video der Fa. Grander berichten Gärtnereien, dass sich
ihre mit Granderwasser gegossenen Pflanzen besser entwickeln und größere
Blütenfülle aufweisen als solche mit Leitungswasser gegossenen.
Das war für uns eine Möglichkeit biologisch die Auswirkungen
der Wasserbelebung nachzuweisen.
Vorgehensweise
Wir besorgten uns 4 Anzuchtkästen mit je 15 Pflanztöpfen
und einem Beutel Anzuchterde. Alle Anzuchtkästen standen in unserem
Wintergarten nebeneinander, so dass pro Versuchsreihe für alle Kästen
die gleichen Standortbedingungen herrschten. Wir kauften verschiedene
Samen und gaben in jedes Pflanztöpfchen die gleiche Menge Erde und
Samen. Dann befüllten wir Sprühflaschen einmal mit Leitungswasser
ohne Grander und einmal mit belebtem Wasser. Parallel wurde je ein Kasten
mit Leitungs- und einer mit Granderwasser gegossen. Uns
interessierte es, ob es unterschiede im Wachstum gibt aber auch, ob wir
einen Unterschied der beiden Wasser-
arten feststellen könnten.
Pflanzenarten für den Versuch
Schalerbsen „Kleine Rheinländerin“ / Pflücksalat
Lollo Rossa“ / Kresse / Spinat „Ballet F1“
Ergebnisse
Gewicht pro Pflanze
Verhältnis umgerechnet in % Mit Leitungswasser gegossen Mit Granderwasser
gegossen
Schalerbsen 100 % 119,1 %
Pflücksalat 100 % 132,4 %
Kresse 100 % 131,9
%
Spinat 100 % 170,6
%
Die chemische Wasseruntersuchung ergab beim pH-Wert , der Carbonat- und
der Gesamthärte leichte Abweichungen zwischen dem Granderwasser und
dem Leitungswasser. Trotz 2maliger Messung blieben die Unterschiede bestehen.
Schlusssatz
Wir konnten feststellen, dass mit Granderwasser gegossene Pflanzen
mehr Wasser verbrauchen. Dies bestätigt auch eine Bäckerei,
die ihren Brotteig mit Granderwasser anrührt. Das Mehl nimmt mehr
Wasser auf, so dass das Brot später nicht so schnell austrocknet.
Wir vermuten, dass auch die Pflanzen das Granderwasser besser aufnehmen
und für sich nutzbar machen können.
Aufgefallen ist uns auch, dass die Samen in den Pflanzschalen mit Deckel
und Lüftung in unserem Wintergarten sehr schnell keimten, die mit
Granderwasser gegossenen Pflanzen aber immer schneller keimten, als die
mit Leitungswasser gegossenen. Auch optisch war das kräftige Wachstum
der Pflanzenblätter zu erkennen sowie die stark ausgebildete Wurzelmasse.
Die Unterschiede bei der chemischen Wasseruntersuchung können wir
nicht
erklären, da es sich ja um das gleiche – von den Stadtwerken
gelieferte – Wasser handelt.
Kurzfassung: Laichwanderung der Erdkröten
in Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchte von Daniel Böhm
(zurück zum Seitenanfang)
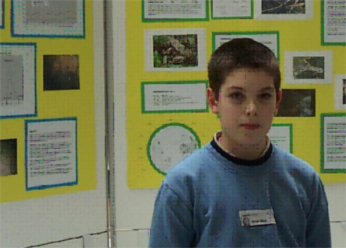
(Daniel Böhm)
Themenwahl
In den letzten Jahren habe ich mit meinen Eltern der Natur- und
Vogelschutzgruppe Meerholz-Hailer geholfen, Erdkröten während
ihrer Laichwanderung über die Straße zu tragen. Dabei ist
mir aufgefallen, dass die Erdkröten an manchen Tagen nicht wanderten.
Mir wurde einmal gesagt:
"Es ist zu kalt", ein anderes Mal "die Luft ist zu trocken".
Ich wollte in diesem Jahr nun wissen,
ab welcher Temperatur und Luftfeuchtigkeit die Kröten zum Wasser
wandern und wann die
kleinen Kröten das Wasser verlassen.
Vorgehensweise
Am 05.03.2003 begann ich mit der Krötenbeobachtung. Jeden
Abend von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr bin ich mit meinen Eltern und anderen
Naturschüzern von der Natur- und Vogelschutzgruppe Meerholz-Hailer
in der Waldstraße in Meerholz gewesen, wo die Erdkröten aus
dem Wald des Meerholzer Heiligenkopfes zum Drosselsee wandern und dabei
die Straße überqueren müssen.
(Siehe Kartenausschnitt auf der nächsten Seite)
In dieser Zeit ist noch ziemlich viel Verkehr, da viele Leute von der
Arbeit zurück kommen. Nach 20.30 Uhr war kaum noch ein Auto zu sehen.
In der Waldstraße ist ein Krötenzaun nicht unbedingt nötig.
Die Häuser haben zum Wald hin gemauerte Gartenumzäunungen. An
diesen entlang laufen die Kröten bis zur nächsten Kreuzung und
dann über die Straße. Eingegrabene Eimer regelmäßig
zu leeren würde mehr Aufwand bedeuten, denn sie müssten auch
am Morgen noch geleert werden. Eine Straßenunterführung wäre
zu aufwändig, da diese nicht nur an einer Stelle verlegt werden müsste.
Wir sammelten also alle Kröten von der Straße auf und trugen
sie in Eimern zum Drosselsee, einer ehemaligen Tongrube unterhalb der
Waldstraße. Dabei wurden alle Tiere bei mir abgeliefert, dann zählte
ich die Tiere.
Bevor ich von zu Hause weggegangen bin, habe ich noch vom Minima-Maxima
–Thermometer die tiefste Temperatur in der Nacht, die höchste
Tagestemperatur, die Temperatur um 19.00 Uhr und vom Hygrometer die relative
Luftfeuchtigkeit abgelesen und aufgeschrieben.
Am 1. April beendete ich die Aktion, da keine Kröten mehr zu finden
waren.
Ergebnisse
Wir trugen insgesamt 938 Erdkröten über die Straße.
Davon waren 689 unverpaarte männliche,
11 unverpaarte weibliche Tiere und 119 Paare. (689 unverp. Männchen
+ 119 Männchen bei den Paaren = insgesamt 808 männliche Tiere
= 86.14%. 11 unverpaarte Weibchen + 119 Weibchen bei den Paaren = 130
weibl. Tiere = 13,86 % )
Die ersten Kröten fanden wir schon am 05.03.2003. Die tiefste Temperatur
betrug an diesem Tag 2,2°C und die höchste 15,5°C. Abends
um 19,00 Uhr war es noch 7,5°C warm und die relative Luftfeuchtigkeit
betrug 51%. Es waren an diesem Abend nur männliche Tiere unterwegs.
An den nächsten beiden Abenden konnten wir keine Kröten beobachten.
Dann aber wurde es wärmer und auch die Kröten begannen in größerer
Anzahl zu wandern. Den ersten Höhepunkt erreichte die Krötenwanderung
am 11. März bei einer Temperatur um 19,00 Uhr von 14,7°C und
einer Luftfeuchtigkeit von 98%. An diesem Abend zählten wir insgesamt
236 Tiere. Davon waren 184 einzelne Männchen und 26 Paare.
Vom 14. bis 23. März waren wieder wenige Tiere unterwegs. Die Nachttemperaturen
waren niedrig, die Tagestemperaturen waren recht warm aber die Luft war
sehr trocken. Der zweite Höhepunkt der Krötenwanderung begann
wieder am 24. März. Es wurde wieder wärmer und die Luft feuchter.
Die ersten Rückwanderer fanden wir am 29.März. Am 1. April
war die Laichwanderung der Erdkröten beendet.
Kurzfassung: Fortsetzung: Blindschleichen
in der Goldhohle von Hailer von Larissa Horn, Melanie Gottwald und Sebastian
Hecht (zurück
zum Seitenanfang)
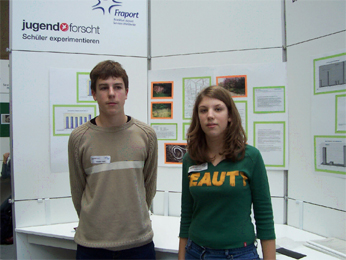
(von lins: Sebastian Hecht
und Larissa Horn)
Im Sommer 2002 wurde in der Gemarkung Hailer eine neue Benjeshecke aufgeschichtet.
Es wurde darüber diskutiert, ob eine solche Maßnahme überhaupt
sinnvoll sei. Da es in der Gemarkung Hailer noch andere Benjeshecken unterschiedlichen
Alters gibt, beschlossen wir, in einer Untersuchung die Vor- bzw. Nachteile
einer Benjeshecke darzustellen.
Eine Hecke besteht aus verschiedenen aneinander gereihten, meist heimischen
Bäumen und Sträuchern. Gehölze in der Feldflur gehören
wegen ihrer Oberfläche, ihrer Vielzahl an Nischen und Schlupfwinkeln
sowie der Mannigfaltigkeit des Futterangebots zu den arten- und individuenreichsten
Biotopen in unserer Landschaft.
Diese Reisighaufen bieten vom 1. Tag an Tieren Unterschlupf, den Vögeln
eine Singwarte, Schutz vor Wind und den im Totholz lebenden Tieren und
Pflanzen Lebensraum. Vögel benutzen den Reisighaufen als Singwarte
und geben dabei Kot ab. Die in diesem Kot als unverdaulich ausgeschiedenen
Samen heimischer Bäume und Sträucher beginnen im Schutz des
Gestrüpps zu keimen. (Die Natur pflanzt nicht, sie sät) Holzige
Hochstauden und junges Gebüsch gehen unmerklich ineinander über.
Das grobe Reisig schützt die Jungpflanzen vor Verbiss und anderen
Beschädigungen, so dass die Pflanzen kräftig wachsen können.
Im Laufe der Zeit wird das Altholz zu Humus und düngt die Pflanzen.
So entsteht eine Hecke aus heimischen Sträuchern zum Nulltarif.
Unsere Untersuchungen ergaben, dass eine Benjeshecke außerhalb
der Ortschaften eine sinnvolle und preisgünstige Alternative zur
gepflanzten Hecke ist.
Voraussetzung ist, dass man der Hecke mindestens 10 Jahre zum Wachsen
einräumt und das Schnittgut in ausreichender Höhe und Breite
aufschichtet. Nach dieser Zeit ist sie von einer gepflanzten Hecke nicht
mehr zu unterscheiden, nur dass die vorkommenden Pflanzenarten die Natur
selber bestimmt hat und diese deshalb besonders vital und widerstandsfähig
sind.
Den Zeitraum der Entwicklung kann man verkürzen, in dem man einige
Heckenpflanzen in Lücken einbringt. Auch einige Bäume sollten
gepflanzt werden. Sie bilden eine 4. Schicht in der Hecke, lockern das
Erscheinungsbild auf und dienen den Tieren, die nur die höheren Bäume
anfliegen, als Singwarte und Ansitzplatz.
Innerörtlich ist eine Benjeshecke aus ästhetischen Gründen
wohl nicht zu empfehlen, da sie doch recht lange einen ungeordneten Eindruck
vermittelt.
Allerdings ist eine gepflanzte Hecke teuer (kosten für Pflanzen und
Arbeitslohn) und in der ersten Zeit pflegebedürftig.
Regionalwettbewerb Hessen Mitte von "Jugend forscht / Schüler
experimentieren" fand in Frankfurt statt.
Die Natur- und Vogelschutzgruppe Meerholz-Hailer war
mit 3 Arbeiten dabei.
Unter dem Motto "Auf einmal ist alles relativ!" fand am 05.
Februar bei der Patenfirma
Fraport AG am Frankfurter Flughafen der Regionalwettbewerb Hessen Mitte
2004 von
"Jugend forscht – Schüler experimentieren" statt.
76 Teilnehmer präsentierten 44 Arbeiten in
den Fachbereichen Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik
und
Informatik, Physik, Technik und Arbeitswelt.
3 Gruppen von der Natur- und Vogelschutzgruppe Meerholz-Hailer waren
bei "Schüler experimentieren", der Juniorsparte von "Jugend
forscht" im Fachbereich Biologie angetreten.
(Hier darf kein Teilnehmer über 16 Jahre alt sein. Der Wettbewerb
endet auf Regionalebene.)
Die Arbeit "Auswirkungen der Wasserbelebung nach Grander auf das
Pflanzenwachstum" von Sebastian und Florian Binder wurde mit dem
Dr. Sobotha- Wasserpreis ausgezeichnet. Sie
wollten wissen, ob es einen Unterschied beim Wachstum gibt zwischen den
Pflanzen, die mit Leitungswasser gegossen wurden und denen, die mit Granderwasser
versorgt wurden. Bei mehreren Versuchen zeigte sich, dass die mit Granderwasser
gegossenen Pflanzen kräftiger waren und mehr Gewicht hatten als die
anderen.
Viel Lob für seine Arbeit mit dem Titel "Laichwanderung der
Erdkröten in Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchte"
erntete auch Daniel Böhm. Er wollte genau wissen, welche Temperaturen
und welche rel. Luftfeuchtigkeit die Laichwanderung der Erdkröten
auslösen.
Er notierte die Tag- und Nachttemperaturen und die Luftfeuchtigkeit. Dann
zählte er die gefundenen Kröten. Er stellte fest, dass die meisten
Kröten bei Nachttemperaturen über 6°C und einer rel. Luftfeuchtigkeit
von über 70% zum Laichgewässer wandern.
Seine Arbeit wurde mit dem 3. Preis belohnt.
Die Jungforschergruppe Larissa Horn, Melanie Gottwald und Sebastian Hecht
beschäftigte sich mit den "Blindschleichen in der Goldhohle
von Hailer". Sie beobachteten als Fortsetzung ihrer Arbeit von 2003
die Blindschleichen, markierten die für kurze Zeit gefangenen Tiere
und stellten deren Gewicht und Länge fest. Außerdem verschafften
sie sich einen Überblick über die Größe und das Alter
der Population. Es wurden verschiedene (weisse, schwarze und transparente)
Folien ausgelegt und unter den Folien die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit
gemessen.
Sie stellten fest, dass es unter den schwarzen Folien am wärmsten
und am trockensten war. Trotzdem wurden unter diesen Folien 80% der Blindschleichen
angetroffen. Unter den transparenten Folien wurde keine Blindschleiche
gefunden.
Die Juroren bescheinigten den Jungforschern großen Fleiss, eine
gute Methodik und übersichtliche Dokumentation ihrer Arbeit. Sie
ermunterten die Gruppe, unbedingt weiter zu forschen, auch
wenn sie diesmal eine Prämierung knapp verpassten.
Alle Teilnehmer an dem Wettbewerb, die für die Natur- und Vogelschutzgruppe
Meerholz-Hailer an den Start gingen, sind Schüler des Grimmelshausen-Gymnasiums
in Gelnhausen.
Der 1. Preis in Biologie ging in diesem Jahr an Schülerinnen der
Henry Harnischfegerschule in Bad Soden-Salmünster und der 2. Preis
an Schülerinnen des Ulrich-von Hutten-Gymnasiums in Schlüchtern.
Bei der Siegerehrung wurde den Teilnehmern große Wissbegier, Kreativität
und Ausdauer bescheinigt. Alle hatten auf selbst gestellte Fragen mit
Engagement und Entschlossenheit Antworten gesucht und gefunden.
|