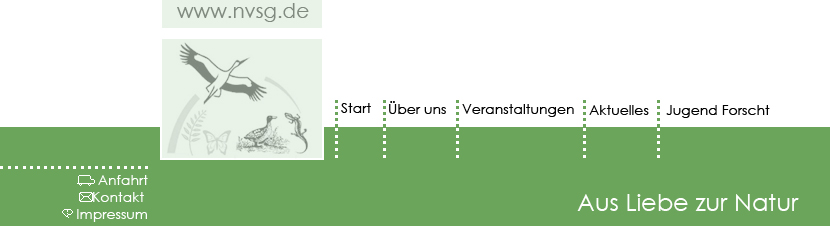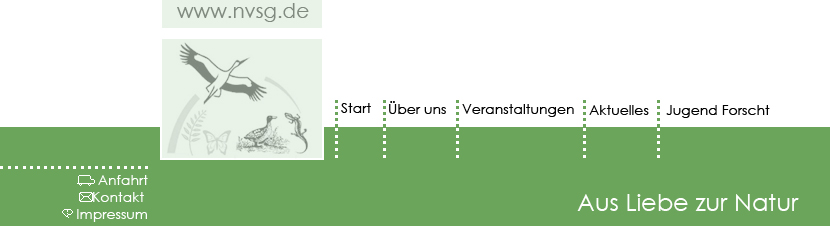Moderlieschen
im Naturteich? : Blindschleichen
in der Goldhole : Vom
Reisighaufen zur Benjeshecke
Kurzfassung: Moderlieschen im Naturteich?
von Sebastian Binder und Florian Binder (zurück
zum Seitenanfang)

(von links: Sebastian Binder
und Florian Binder)
Thema
Moderlieschen im Naturteich?
Themenfindung
Nachdem ich, Sebastian, bereits mit zwei Arbeiten über unseren Garten,
seine Umgestaltung und Anlage als Biotop teilgenommen habe, sah ich mir
im laufenden Jahr unser Ökosystem Teich zusammen mit meinem Bruder,
Florian, genauer an. Die Moderlieschen wurden bewusst in den Teich gesetzt.
Wir wollten wissen, ob sie das Ökologische Gleichgewicht des Teiches
stören oder nicht.
Lage des Teiches
Unser Teich ist ein Teil eines Naturgartens. Er wird im Westen gesäumt
von einem Schilfgürtel, hat nördlich einen Bachzulauf, ist im
Osten frei zugänglich und wird im Süden von einem großen
Bergahorn beschattet. Der Garten liegt in einem alten Ortskern und war
früher Teil landwirtschaftlicher Gehöfte.
Beschreibung des Teiches
Unser Teich ist ein Folienteich. Die Oberfläche beträgt ca.
13 qm. Angelegt wurde er mit Stufen in den Höhen 0-0,10m, 0,20m,
0,35m, 0,75m, 1,10m. Hierbei wurden die verschiedenen Vegetationsstufen
und ihre Bewohner berücksichtigt. Die Anlage erfolgte im Frühjahr
2001. Der Moderlieschenbesatz fand im gleichen Sommer statt, die Tiere
werden nicht gefüttert.
Vorgehensweise
Wir begannen am 29. April 2002 mit der Teichbeobachtung. Als erstes legten
wir uns eine Liste der Wasserpflanzen an. Danach wurden die Teichbewohner
und Teichbesucher erfasst. Dazu nutzten wir verschiedene Bestimmungsbücher
und ein Binokular. Bei den angelegten Protokollen wurden auch Wassertemperatur,
Lufttemperatur, Tageszeit und Wetterlage notiert. Einmalig führten
wir eine chemische Analyse durch.
Ergebnis
Tierarten am Teich: 32
Tierarten im Teich: 18
Pflanzenarten im und am Teich: 30
Gefundene Exuvienarten: 2
Es konnte keine Beeinträchtigung des Ökosystems Teich durch
die Moderlieschen festgestellt werden. Der Teich wurde nicht, wie zunächst
vermutet, leergefressen.
Kurzfassung: Blindschleichen in der
Goldhole von Hailer von Larissa Horn, Melanie Gottwald und Sebastian Hecht
(zurück zum Seitenanfang)
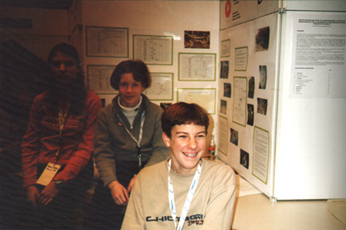
(von links: Larissa Horn, Melanie Gottwald und Sebastian Hecht)
Ältere Mädchen aus unserer Gruppe haben uns erzählt, dass
es in der Goldhole in Hailer Blindschleichen gäbe und dass, wenn
man schwarze Folie auslege, sie sich dort verkriechen und man sie gut
beobachten könnte.
Das interessierte uns und wir beschlossen, die Blinschleichenpopulation
in der Goldhole näher zu erforschen.
Zuerst einmal wollten wir feststellen, wie viele Blindschleichen es ungefähr
in der Goldhole gibt. Dann interessierte uns, ob die Blindschleichen immer
die gleiche Folie als Unterschlupf benutzen oder ob sie ihre Ruheplätze
wechseln. Außerdem wollten wir wissen, wie schwer und wie lang die
gefundenen Blinschleichen sind.
Wir begannen unsere Beobachtungen Mitte Mai und beendeten sie Mitte September.
Zuerst besorgten wir uns 1mm dicke schwarze Folie. Diese Schnitten wir
auf eine Größe von 70cm auf 100cm zurecht und legten sie an
sieben verschiedenen Stellen in der Goldhole aus.
Dann besorgten wir uns Lösungsmittel freie, also ungiftige Plakafarbe
in verschiedenen Farben. Mit diesen betupften wir die gefangenen Blinschleichen,
damit wir sie später wieder erkennen konnten. Wenn die aufgetragene
Farbe getrocknet war und wir die Tiere gemessen und gewogen hatten, setzten
wir sie an genau der Stelle aus, wo wir sie gefangen hatten.
Bei jedem Widerfang wurde die Markierung erneuert.
Die gefundenen Maße und Gewichte sowie die angebrachten Markierungen
trugen wir in ein Protokoll ein. Hierin vermerkten wir auch das Datum,
die Lufttemperatur und unter welcher Folie wir welches Tier gefunden hatten.
Unter den ausgelegten Folien in einem Areal von ca. 3000m² fanden
wir 22 verschiedene Blindschleichen.
Unter Folie A wurden 4x, unter Folie B 23x, unter Folie C 4x, unter Folie
D 7x, unter Folie E 9x, unter Folie F 3x und unter Folie G 0x keine Blindschleichen
gefunden.
Von den 22 Tieren wurden 9 nur einmal angetroffen, 7 wurden 2x gefunden,
2 Tiere 3x, 3 Blindschleichen wurden 4x und 1 Tier 5x registriert.
Die gefundenen Maße und Gewichte waren sehr unterschiedlich. Die
kleinsten Blinschleichen hatten ein Gewicht von 1,5g und waren 11cm lang.
Es handelte sich sicher um die im letzten Jahr geborenen Jungtiere. Beim
schwersten Tier registrierten wir eine Länge von 35cm und ein Gewicht
von 30g. Dieses Tier war eindeutig trächtig. Das zweitschwerste Tier
hatte 18g bei einer Länge von 33cm.
Über die Gewichts- und Längenzuwächse im Beobachtungszeitraum
stellten wir folgendes fest: Alle Tiere wuchsen zwischen 0,5cm und 2,5cm
und nahmen an Gewicht zwischen 0,5g und 2,5g zu.
Über das Wanderverhalten konnten wir folgendes feststellen:
1 Tier wurde unter 4 verschiedenen Folien angetroffen. 2 Blindschleichen
suchten 3 verschiedene Folien auf, 6 Tiere benutzten 2 verschiedene Folien
als Unterschlupf und 13 Blindschleichen wurden entweder nur 1x registriert
oder benutzten immer die gleiche Folie.
Kurzfassung: Vom Reisighaufen zur
Benjeshecke von Sandra Reichert und Lena Wickert (zurück
zum Seitenanfang)

(von lins: Sandra Reichert
und Lena Wickert)
Im Sommer 2002 wurde in der Gemarkung Hailer eine neue Benjeshecke aufgeschichtet.
Es wurde darüber diskutiert, ob eine solche Maßnahme überhaupt
sinnvoll sei. Da es in der Gemarkung Hailer noch andere Benjeshecken unterschiedlichen
Alters gibt, beschlossen wir, in einer Untersuchung die Vor- bzw. Nachteile
einer Benjeshecke darzustellen.
Eine Hecke besteht aus verschiedenen aneinander gereihten, meist heimischen
Bäumen und Sträuchern. Gehölze in der Feldflur gehören
wegen ihrer Oberfläche, ihrer Vielzahl an Nischen und Schlupfwinkeln
sowie der Mannigfaltigkeit des Futterangebots zu den arten- und individuenreichsten
Biotopen in unserer Landschaft.
Diese Reisighaufen bieten vom 1. Tag an Tieren Unterschlupf, den Vögeln
eine Singwarte, Schutz vor Wind und den im Totholz lebenden Tieren und
Pflanzen Lebensraum. Vögel benutzen den Reisighaufen als Singwarte
und geben dabei Kot ab. Die in diesem Kot als unverdaulich ausgeschiedenen
Samen heimischer Bäume und Sträucher beginnen im Schutz des
Gestrüpps zu keimen. (Die Natur pflanzt nicht, sie sät) Holzige
Hochstauden und junges Gebüsch gehen unmerklich ineinander über.
Das grobe Reisig schützt die Jungpflanzen vor Verbiss und anderen
Beschädigungen, so dass die Pflanzen kräftig wachsen können.
Im Laufe der Zeit wird das Altholz zu Humus und düngt die Pflanzen.
So entsteht eine Hecke aus heimischen Sträuchern zum Nulltarif.
Unsere Untersuchungen ergaben, dass eine Benjeshecke außerhalb
der Ortschaften eine sinnvolle und preisgünstige Alternative zur
gepflanzten Hecke ist.
Voraussetzung ist, dass man der Hecke mindestens 10 Jahre zum Wachsen
einräumt und das Schnittgut in ausreichender Höhe und Breite
aufschichtet. Nach dieser Zeit ist sie von einer gepflanzten Hecke nicht
mehr zu unterscheiden, nur dass die vorkommenden Pflanzenarten die Natur
selber bestimmt hat und diese deshalb besonders vital und widerstandsfähig
sind.
Den Zeitraum der Entwicklung kann man verkürzen, in dem man einige
Heckenpflanzen in Lücken einbringt. Auch einige Bäume sollten
gepflanzt werden. Sie bilden eine 4. Schicht in der Hecke, lockern das
Erscheinungsbild auf und dienen den Tieren, die nur die höheren Bäume
anfliegen, als Singwarte und Ansitzplatz.
Innerörtlich ist eine Benjeshecke aus ästhetischen Gründen
wohl nicht zu empfehlen, da sie doch recht lange einen ungeordneten Eindruck
vermittelt.
Allerdings ist eine gepflanzte Hecke teuer (kosten für Pflanzen und
Arbeitslohn) und in der ersten Zeit pflegebedürftig.
|